von Sebastian Zender
Weltweit leben mehr als 150 Millionen Menschen als Migranten in einem Staat, der nicht ihre ursprüngliche Heimat ist. Das entspricht etwa der doppelten Bevölkerungszahl der Bundesrepublik Deutschland. Was sind die Gründe für diese Wanderungen über Staatsgrenzen hinweg und mit welchen Problemen haben Migranten zu kämpfen? Wie hat sich die Situation von Zuwanderern und Flüchtlingen in Deutschland und Europa in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Andere sehen dort, wo sie leben, für sich und ihre Kinder einfach keine Zukunft mehr und beschließen deshalb, ihr Glück an einem anderen Ort zu versuchen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern zum Beispiel ziehen in letzter Zeit immer mehr Menschen vom Land in die Städte, weil sie hoffen, dort eher eine Arbeit zu finden. Der Oberbegriff für alle diese Wanderungen ist "Migration". Das Wort stammt vom lateinischen "migrare", das so viel wie "wandern" oder "sich bewegen" bedeutet. Man kann hier auch noch eine genauere Unterscheidung treffen: Mit "Immigration" ist Einwanderung gemeint, während "Emigration" Auswanderung bedeutet.
Deutschland - ein Einwanderungsland

Ausländer sind jedoch nur eine Teilgruppe der in Deutschland lebenden Menschen mit einem "Migrationshintergrund". Dazu zählen auch die so genannten (Spät-)Aussiedler, Menschen mit deutscher Herkunft, die in anderen Ländern - vor allem der ehemaligen Sowjetunion, aber auch in Rumänien, Polen, Ungarn und der ehemaligen Tschechoslowakei - lebten. Sie und ihre Familien hatten lange freies Zuzugsrecht nach Deutschland. Auch inzwischen eingebürgerte Ausländer sowie deren Kinder, die in Deutschland als Deutsche geboren wurden, zählen zu dieser Gruppe. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung beträgt mit 15,3 Millionen Menschen 18,4 Prozent. Da auch in Deutschland geborene Kinder zu dieser Gruppe gerechnet werden, haben nur zwei Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund auch eigene Migrationserfahrung - also selbst den Umzug in ein anderes Land erlebt.

Das "Wirtschaftswunder" und die "Gastarbeiter"
Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 erlebte die westdeutsche Wirtschaft einen unverhofften Aufschwung, der dazu führte, dass ein Mangel an Arbeitskräften herrschte. Deshalb wurden von 1955 bis 1973 Millionen von Arbeitern aus dem Ausland angeworben, die maßgeblich zum so genannten deutschen "Wirtschaftswunder" beigetragen haben. Die ersten dieser so genannten "Gastarbeiter" kamen aus Italien, später dann auch aus Spanien, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Sie mussten häufig besonders schwere oder schmutzige Arbeit verrichten und wurden schlecht bezahlt.

Der Schriftsteller Max Frisch schrieb dazu: "Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen." Aus "Gastarbeitern" wurden Einwanderer. Sie und ihre Familien bilden noch immer die größte Gruppe der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Das Migrationsgeschehen in der damaligen DDR war ebenfalls, wenn auch in geringerem Umfang als in der Bundesrepublik, von der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte gekennzeichnet. Der dortige Arbeitskräftemangel war vor allem darauf zurückzuführen, dass von 1949 bis zum Mauerbau 1961 mehr als 2,7 Millionen Menschen von Ost- nach Westdeutschland abwanderten. Zwischen 1966 und 1989 warb die DDR rund 500.000 Arbeitskräfte aus Vietnam, Polen, Mosambik und anderen Staaten an. Sie arbeiteten unter schweren Bedingungen und lebten meist von der restlichen Bevölkerung getrennt in Gemeinschaftsunterkünften.
"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht"

Das damals weltweit offenste Asylrecht gewährte allen, die glaubten, Anspruch darauf anmelden zu können, zumindest bis zur Entscheidung über ihren Antrag einen sicheren Aufenthalt. Auch in der DDR war das Asylrecht in der Verfassung verankert - vor allem Flüchtlinge aus Spanien, Chile und Griechenland wurden bis Mitte der siebziger Jahre aufgenommen. Wie bei den "Gastarbeitern" lagen aber auch hier die Zahlen deutlich unter denen von Westdeutschland. Beide Länder gehörten außerdem zu den mittlerweile 144 Unterzeichnerstaaten der "Genfer Flüchtlingskonvention", die vorschreibt, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen zumindest vorübergehend Schutz zu gewähren.
"Grundrecht auf Asyl" wurde immer weiter eingeschränkt

Gegen Ende der siebziger Jahre stiegen die Zahlen der Asylanträge deutlich an. Die Flüchtlinge stammten jetzt nicht mehr vorwiegend aus den "Ostblockstaaten", sondern meist aus den als "Dritte Welt" bezeichneten armen Ländern in Südamerika, Afrika und Asien. Als Reaktion auf die steigenden Antragszahlen wurde die Asylvergabe zunächst in der Praxis stark eingeschränkt. Schließlich wurde der Begriff der politischen Verfolgung auch gesetzlich immer enger gefasst und dadurch das Grundrecht auf Asyl nach und nach ausgehöhlt. So galt zum Beispiel selbst Folter, wenn sie in einem Verfolgerstaat als Bestrafung für die Inanspruchnahme verbotener demokratischer Grundrechte üblich war, nicht mehr als Asylgrund.
In den folgenden beiden Teilen unserer Reihe über Migration wirst du mehr erfahren über die Situation für Flüchtlinge und Migranten, das Thema Integration und das Problem der Fremdenfeindlichkeit sowie die Debatte um die "Festung Europa".
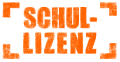
Hinweis zum Copyright: Die private Nutzung unserer Webseite und Texte ist kostenlos. Schulen und Lehrkräfte benötigen eine Lizenz. Weitere Informationen zur SCHUL-LIZENZ finden Sie hier.
Wenn dir ein Fehler im Artikel auffällt, schreib' uns eine E-Mail an redaktion@helles-koepfchen.de. Hat dir der Artikel gefallen? Unten kannst du eine Bewertung abgeben.









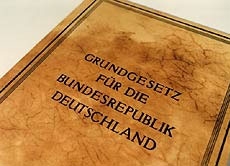

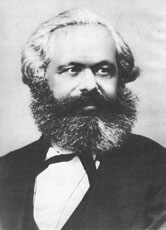




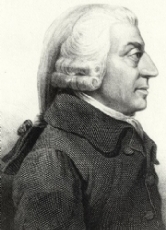
 Was kann der Beo recht gut?
Was kann der Beo recht gut?