von Sebastian Zender
Die größte Zuwanderungswelle erlebte Deutschland von 1988 bis 1993. In dieser Zeit kamen 7,3 Millionen Aussiedler, Asylbewerber, neue "Gastarbeiter" und nachziehende Familienangehörige ins Land, während nur 3,6 Millionen Personen Deutschland verließen. Es kam zu einer steigenden Fremdenfeindlichkeit, was nicht zuletzt daran lag, dass Politiker das schwierige Thema für Wahlkämpfe missbrauchten und - von Medien unterstützt - gegen angeblichen "Asylmissbrauch" Stimmung machten. Durch strengere Gesetze wurde es immer schwieriger für Flüchtende, Asyl in Deutschland zu bekommen. Zunehmend wurde über das Problem der mangelnden Eingliederung diskutiert. Noch immer sind viele Migranten kaum in die Gesellschaft integriert.

Dies war jedoch unbegründet: Seit 1987 durften Asylbewerber für fünf Jahre - also meist die gesamte Zeit, in der ihr Antrag bearbeitet wurde - keine Arbeit annehmen. Auch nachdem diese Regelung 1991 aufgehoben wurde, war gesetzlich vorgeschrieben, dass Inländer gegenüber Arbeit suchenden Asylbewerbern grundsätzlich Vorrang hatten. Doch kam es in ganz Deutschland vermehrt zu gewalttätigen und teils tödlichen Übergriffen gegen Migranten oder deutsche Staatsbürger mit dunkler Hautfarbe.
Gewalt gegen Migranten

Die Vietnamesen und das ZDF-Team konnten sich nur dadurch retten, dass sie aufs Dach des Hauses stiegen, da die deutschen Nachbarn die Notausgänge zu den Nachbarhäusern mit Ketten zugesperrt hatten. Erst nach vier Tagen gelang es der vollkommen überforderten Polizei, die Krawalle in den Griff zu bekommen. 204 Polizeibeamte wurden teils schwer verletzt.
Strengere Gesetze und weniger Zuwanderer

Alle an Deutschland angrenzenden Länder gelten als solche "sicheren Drittstaaten". Flüchtlingen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen möchten, bleibt also nur noch die Möglichkeit, mit dem Flugzeug anzureisen. Dies können sich die meisten aber überhaupt nicht leisten. Außerdem dürfen Flüchtlinge, die aus einem "verfolgungsfreien" Staat anreisen oder über keine gültigen Papiere verfügen, den Flughafen nicht verlassen. Über ihren Asylantrag wird in einem Schnellverfahren entschieden und im Falle der Ablehnung müssen sie sofort wieder zurück in ihre Herkunftsländer.
Diese höheren gesetzlichen Hürden haben - zusammen mit verschärften Kontrollen an den Grenzen - dazu geführt, dass sich die Einwandererzahlen drastisch reduziert haben. Während 1991 knapp 428.000 Menschen durch Immigration hinzukamen, waren es 1996 noch 149.000 und 2004 nur noch 55.000. Inzwischen gibt es sogar mehr Fort- als Zuzüge von Ausländern. Noch immer verbreiten rechte Politiker und ihre Anhänger gerne die Behauptung, Deutschland werde geradezu von Ausländern überschwemmt. In Wirklichkeit ist aber genau das Gegenteil der Fall: Heute lebt mehr als die Hälfte der 7,3 Millionen Ausländer schon zehn Jahre oder länger in Deutschland, darunter ein Drittel sogar länger als 20 Jahre. Und jeder fünfte "Ausländer" ist überhaupt kein Zuwanderer, sondern bereits in der Bundesrepublik geboren.
Rot-Grün sorgte für Veränderungen

Ursprünglich wollten SPD und Grüne mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht die so genannte "Doppelte Staatsbürgerschaft" einführen. Dadurch wäre es in Deutschland geborenen Kindern von Migranten, deren Eltern schon seit mehr als acht Jahren in Deutschland leben, möglich gewesen, sowohl die deutsche als auch die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern zu übernehmen. Die CDU startete daraufhin eine Unterschriftenaktion gegen dieses Vorhaben, die häufig als politische Stimmungsmache auf Kosten von Migrantinnen und Migranten kritisiert wurde. Da die von der CDU regierten Länder damals eine Mehrheit im Bundesrat hatten, der dem Gesetzesvorhaben hätte zustimmen müssen, konnten SPD und Grüne sich letztlich nicht durchsetzen. Als Kompromiss einigten sich die Parteien schließlich auf das "Optionsrecht". Das bedeutet, dass hier geborene Kinder von Migranten sich mit Erreichen des 18. Lebensjahres für eine der beiden Staatsbürgerschaften entscheiden müssen.
Das neue Zuwanderungsgesetz von 2005 knüpfte, was Zuwanderung und die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, zwar in großen Teilen die schon zuvor bestehenden gesetzlichen Strukturen an, doch es lag zum ersten Mal ein Gesetz vor, das alle Bereiche der Migrationspolitik umfassend regelte. Insbesondere rückte es ein bislang vernachlässigtes Thema in den Mittelpunkt: "Integration" wurde zum Zauberwort in der politischen und öffentlichen Diskussion über Zuwanderung in Deutschland.
Die Debatte um Integration

Diese beiden Erkenntnisse führten dazu, dass man sich die Frage stellte, wie bereits in Deutschland lebende und zukünftig in unser Land kommende Zuwanderer besser in die Gesellschaft "integriert" werden können. "Integration" kommt vom lateinischen Wort "integer", das sich mit "ganz" übersetzen lässt. Es bedeutet also soviel wie "Herstellung eines Ganzen". In Bezug auf Migration ist damit all das gemeint, was dazu führen soll, dass Zuwanderer und die heimische Bevölkerung eine harmonische Einheit bilden.
Damit Integration gelingen kann, bedarf es Anstrengungen von beiden Seiten. Seit dem Zuwanderungsgesetz von 2005 ist die Förderung der Integration als Aufgabe des Staates gesetzlich verankert. Es wurden Integrationskurse eingeführt, in denen Zuwanderern die deutsche Sprache und Kenntnisse der deutschen Gesellschaft vermittelt werden sollen. Zuvor waren solche Angebote viel zu selten. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass manche Zuwanderer, obwohl sie schon viele Jahre in Deutschland lebten, nur schlecht Deutsch sprachen und deshalb zum Beispiel im Umgang mit Behörden Probleme hatten oder ihren Kindern nur schwer bei den Hausaufgaben helfen konnten.
Mehr Anforderungen an Migranten

Zu bedenken ist, dass deutsche Staatsbürger hierzu auch keine Fragen beantworten müssen und vermutlich längst nicht alle Antworten auf die Wissensfragen wüssten. Maßnahmen wie diese, die an manchen Schulen eingeführte Pflicht, auf dem Schulhof Deutsch zu sprechen, oder das Gesetz, dass es Lehrerinnen verbietet, ein Kopftuch zu tragen, werden von vielen auch kritisch gesehen. Viele deutsche Urlauber scheren sich kaum um die Gebräuche anderer Länder und einige deutsche Auswanderer machen sich auch nicht die Mühe, die jeweilige Landessprache zu lernen. Insgesamt ist man sich weitestgehend einig, dass Integration nicht einfach nur in einer "Anpassung" der Zuwanderer bestehen kann, auch die eigene Gesellschaft muss offener werden.
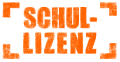
Hinweis zum Copyright: Die private Nutzung unserer Webseite und Texte ist kostenlos. Schulen und Lehrkräfte benötigen eine Lizenz. Weitere Informationen zur SCHUL-LIZENZ finden Sie hier.
Wenn dir ein Fehler im Artikel auffällt, schreib' uns eine E-Mail an redaktion@helles-koepfchen.de. Hat dir der Artikel gefallen? Unten kannst du eine Bewertung abgeben.




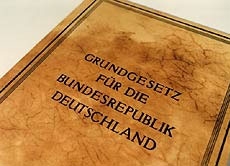







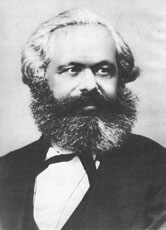




 Welches Nashorn gibt es wirklich?
Welches Nashorn gibt es wirklich?