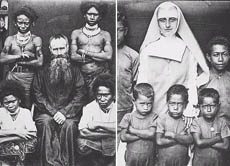
Suchergebnisse
-
Frühmittelalter - Wulfila im Dienste der Christianisierung
Um das Jahr 350 n. Chr. übersetzte Bischof Wulfila die Bibel ins Gotische und legte damit den Grundstein für die Christianisierung vieler Germanen. Wulfila gehörte zum Stamm der Goten und galt dort als geistlicher Führer. Sein Ziel war, dass seine Stammesbrüder den Gottesdienst verstehen können sollten.
http://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/lucys-wissensbox/kategorie/religion-warum-ging-mohammed-nach-mekka-und-warum-faellte-bonifatius-eine-eiche/frage/wulfila-im-dienste-der-christianisierung.html?no_cache=1&ht=4&ut1=9
-
Mission | einfach erklärt für Kinder und Schüler
19.10.2011 - Das Wort "Mission" kommt von dem lateinischen Verb "mittere", das entsenden und schicken bedeutet. Man versteht darunter einen Auftrag oder eine Aufforderung zu einer bestimmten Handlung. Der Begriff wird vor allem in politischen und religiösen Zusammenhängen verwendet. In der Politik ist damit zum Beispiel die Vertretung eines Landes in ausländischen Staaten oder bei internationalen Organisationen gemeint.
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3188.html
-
Christliche Missionierungsarbeit
In ihren Anfängen ist die deutsche Literatur sprachlich kein einheitliches, sondern vielmehr ein mehrsprachiges Gebilde, wobei das Latein als „Hochsprache“ aller germanischen Stämme fungierte.
Aus dem Inhalt:
[...] zur Christianisierung der von ihm eroberten sächsischen Lande. Die in dieser Zeit entstandene Literatur trug Missions- und Bildungscharakter. Im 10. Jahrhundert [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/christliche-missionierungsarbeit
-
Otto I., der Große
* 23.11.912 in Wallhausen † 07.05.973 in Memleben OTTO I. wird als der bedeutendste Ottonenherrscher betrachtet. Seit 936 deutscher König und infolge seiner zweiten Heirat mit der Königinwitwe ADELHEID 951 auch italienischer König, wurde er 962 vom Papst in Rom zum römischen Kaiser gekrönt.
Aus dem Inhalt:
[...] Missionsstützpunkt bei der Eroberung slawischer Gebiete und deren Christianisierung aus. WIDUKIND VON CORVEY beschrieb in seiner „Sachsengeschichte“ OTTO den Großen [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/otto-i-der-grosse
-
Runen
Bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts las und schrieb im deutschen Sprachraum fast niemand. Die germanischen Stämme benutzten als Schriftzeichen Runen. Das althochdeutsch-gotische „runa“ bedeutet „Geheimnis“; neuhochdeutsch bedeutet es „raunen“.
Aus dem Inhalt:
[...] wurden nachweislich in Nordeuropa vom 1. Jahrhundert n.Chr. bis weit in das Mittelalter hinein benutzt. Sie verschwanden als allgemeines Schriftsystem zunehmend mit der Durchsetzung der lateinischen Schrift im Zuge der Christianisierung. [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/runen
-
Der lateinsche Einfluss
Die Ausprägung der englischen Sprache in ihrer heutigen Form ist das Ergebnis einer langen, über viele Jahrhunderte andauernden Entwicklung, die in verschiedene Perioden eingeteilt wird.
Aus dem Inhalt:
[...] auf das Altenglische im Zuge der Christianisierung aus, die in der Mitte des Jahrhunderts durch irische Mönche ihren Anfang nahm. [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/englisch-abitur/artikel/der-lateinsche-einfluss
-
Stoffliche Zuordnung
Das „Hildebrandslied“ ist das einzig erhaltene althochdeutsche Heldenlied und in seiner tradierten Form etwa um 770–780 entstanden. Es setzt sich aus langobardischen, bairischen und niederdeutschen Elementen zusammen und besteht aus stabreimenden Langzeilen.
Aus dem Inhalt:
[...] Hildebrand (dem Waffenmeister DIETRICHs) und Hadubrand. Auffällig im „Hildebrandslied“ ist die Christianisierung germanischer Gottheiten. Das „ Hildebrandslied [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/stoffliche-zuordnung
-
Arten althochdeutscher Dichtung
Die althochdeutschen Schriften waren vor allem für die Menschen des Mittelalters bestimmt, die des Lateinischen nicht mächtig waren. Literatur wurde damals in erster Linie mündlich überliefert und konnte durch Vorlesen auch den Analphabeten mitgeteilt werden.
Aus dem Inhalt:
[...] So beruht der niedersächsische, zur Christianisierung der Sachsen eingesetzte, „Heliand“ sowohl auf alten germanischen Heldenvorstellungen, als auch auf der Geschichte des Heilands im Neuen Testament. [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/arten-althochdeutscher-dichtung
-
Interpretation des Hildebrandslieds
Das „Hildebrandslied“ ist das einzig erhaltene althochdeutsche Heldenlied und in seiner tradierten Form etwa um 770–780 entstanden. Es setzt sich aus langobardischen, bairischen und niederdeutschen Elementen zusammen und besteht aus stabreimenden Langzeilen.
Aus dem Inhalt:
[...] Hildebrand (dem Waffenmeister DIETRICHs) und Hadubrand. Auffällig im „Hildebrandslied“ ist die Christianisierung germanischer Gottheiten. Historische Zuordnung [...]
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/interpretation-des-hildebrandslieds
-
Die römisch-katholischen Bischöfe
09.06.2015 - Waren Bischöfe zu Beginn der Christianisierung eher bescheiden lebende Vorsteher einer Gemeinde, wurden sie in Mittelalter und Neuzeit einflussreiche und mächtige Kirchenfürsten. Heute kann man Bischöfe als Manager im Dienste des Vatikans bezeichnen.
http://www.planet-wissen.de/kultur/religion/das_christentum/pwiedieroemischkatholischenbischoefe100.html
Wie bewertest du die Suchmaschine von Helles Köpfchen? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Findest du die Darstellung der Suchergebnisse übersichtlich? Deine Angaben helfen uns, die Suchmaschine zu verbessern. Wähle zwischen einem Stern (schlecht) und fünf Sternen (super). Zusätzlich kannst du einen Kommentar abgeben. Die mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.
| Name und Alter | Sterne | Kommentar |
|---|







